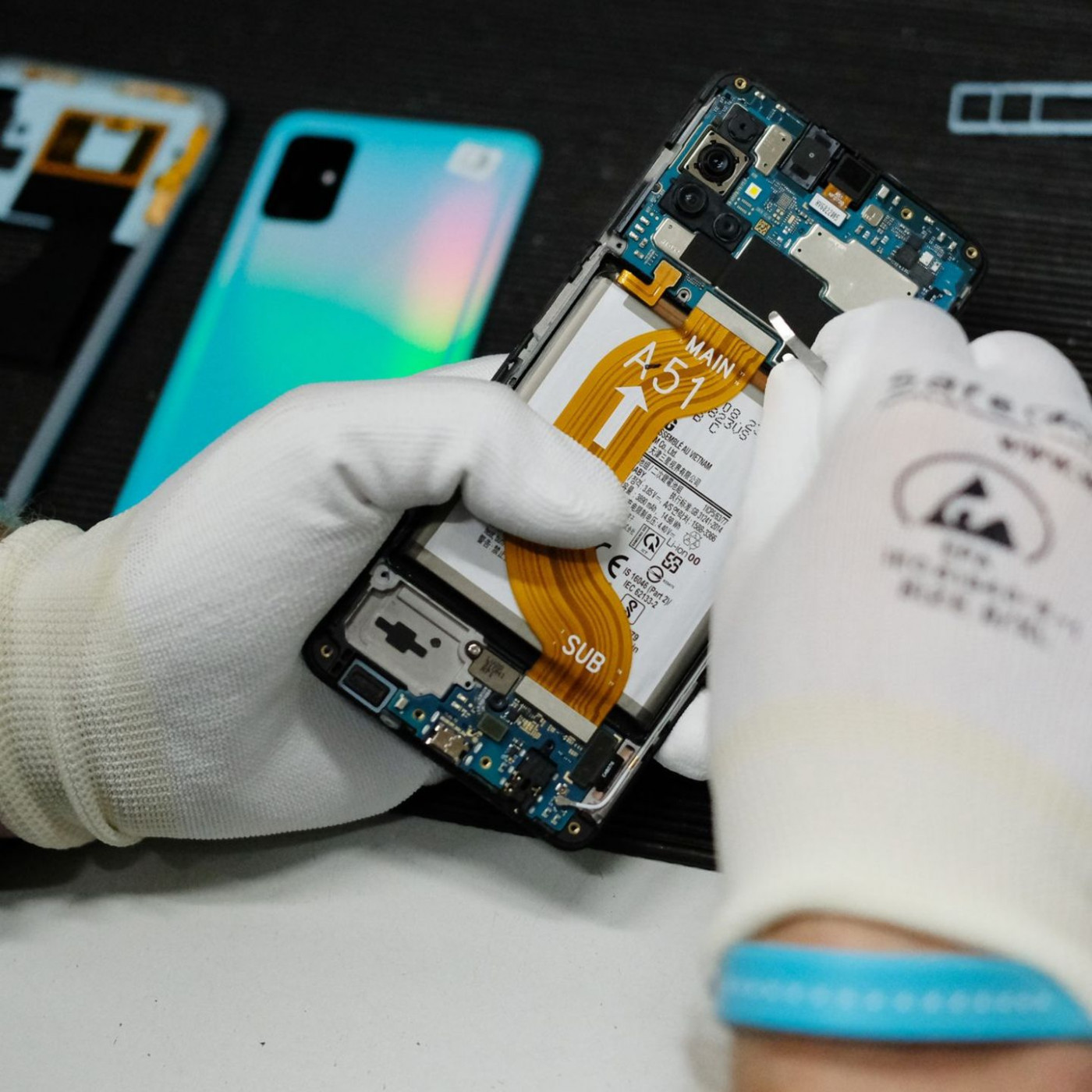Die Industrie wandert ab – aber Hauptsache, wir sind die Moral-Weltmeister
Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, an einer Tagung von Führungskräften deutscher Industrieunternehmen teilzunehmen. Das Motto war „Handeln statt zu jammern“. Ich war gespannt, was sich die Führungskräfte unter „Handeln“ vorstellen würden. Gab es vielleicht einen Weg, der die Industrie am Standort Deutschland trotz der zahlreichen Knüppel, welche die Politik ihr laufend zwischen die Beine wirft, zum Erfolg führen könnte?
Meine Antwort war schon länger „nein“ gewesen, aber vielleicht hatte ich ja etwas verpasst. Leider war dem nicht so. „Handeln“, so stellte sich im Laufe der Tagung heraus, bedeutete schlichtweg Abwanderung.
Der schon länger wirksame Treiber für die Abwanderung geht von den Produktionskosten aus. Die wuchernde Bürokratie quält mit „Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz“, „Datenschutzgrundverordnung“ und anderen Marterinstrumenten die Unternehmen bis aufs Blut. Die verkorkste Energiewende sorgt für Spitzenpreise für Energie. Die Produktivität der Beschäftigten pro Kopf sinkt und die Löhne steigen kräftig, sodass die „Lohnstückkosten“ aus dem Ruder laufen.
Zu diesen längst bekannten „Push-Faktoren“ kam in der jüngsten Vergangenheit ein weiterer dazu: die Zerstörung der freiheitlichen Welthandelsordnung durch den US-Präsidenten Donald Trump. Dadurch entstehen mit mehr oder weniger hohen Handelsbarrieren voneinander getrennte Märkte in den USA, Asien und Europa. Belieferten deutsche Industrieunternehmen in der Vergangenheit den Weltmarkt mit Produkten „Made in Germany“, so müssen sie heute für die Kunden in den verschiedenen Regionen weitgehend vor Ort produzieren. Fabriken in den USA, China und Europa liefern ihre Produkte an die jeweiligen Kunden in diesen Regionen.
Die unmittelbare Folge davon ist ein Abbau der Wertschöpfung in Deutschland und Aufbau anderswo. Für die Bundesrepublik bedeutet dies einen Verlust von produktiven Arbeitsplätzen. Was bleibt, ist eine geringere Anzahl weniger produktiver Plätze im Dienstleistungssektor und im öffentlichen Dienst. Angesichts der altersbedingt schrumpfenden Erwerbsbevölkerung muss dies nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen. Aber der Wohlstand sinkt.
Im Wahlkampf hatte die CDU/CSU unter anderem eine „Agenda 2030“ zur Erneuerung des Wirtschaftsstandorts Deutschland versprochen. In der schwarz-roten Regierungskoalition dürfte davon nichts mehr übrig bleiben. Die Hoffnung der Tagungsteilnehmer war darauf geschrumpft, dass es unter dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz wenigstens nicht noch schlimmer kommen würde als unter seinen Vorgängern Angela Merkel und Olaf Scholz. Sollte nicht noch ein Wunder geschehen, dürfte Schwarz-Rot folglich die Abwanderung der Industrie und die Deindustrialisierung Deutschlands kaum stoppen können.
Die Regierung Merz will mit Geld nur so um sich werfen. Das könnte der Wirtschaft einen Zuckerrausch verpassen. Aber wenn es nicht zu grundlegenden Änderungen der Politik kommt, dürfte dieser schnell wieder verfliegen. Am Ende könnte Deutschland nur auf einem hohen Schuldenberg sitzen und alles andere unverändert bleiben. Allenfalls könnte die „Buy European“-Rüstungspolitik das Bild etwas aufhellen. Doch inwieweit die staatliche Rüstungsbürokratie in die Puschen kommt und Pflugscharen in Schwerter gewandelt werden können, ist unsicher.
Immerhin können sich die Klimaschützer und die „De-Growth“-Bewegung freuen. Mit der Deindustrialisierung sinkt der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland weiter. Dass er dafür anderswo steigt, ist nicht so wichtig. Denn worauf es wirklich ankommt, ist ja, dass wir weiterhin die Weltmeister im Moralismus bleiben.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke